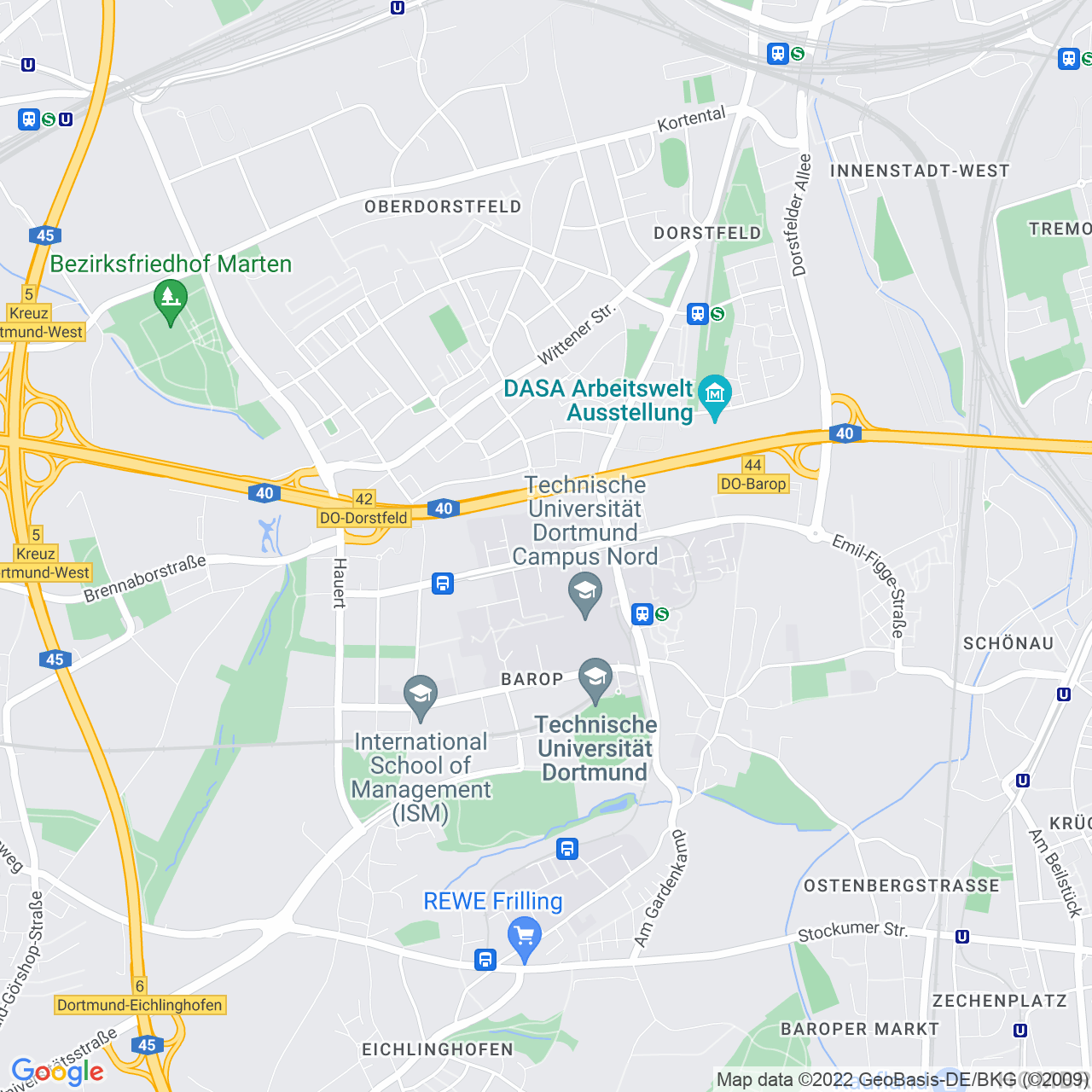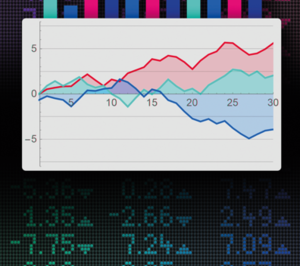Allen Menschen mit Beeinträchtigungen gleiche Chancen auf soziale Teilhabe ermöglichen
Der Master-Studiengang Rehabilitationswissenschaften ist forschungsbasiert, zukunftsorientiert, anwendungsbezogen. Diese Orientierungen sind prägend für seine Konzeption und Modulstruktur.
- Der Studiengang ist forschungsbasiert.
Ziel rehabilitationswissenschaftlicher Forschung ist wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn, um darüber einen Mehrwert für Menschen mit Unterstützungsbedarf zu erlangen. Die Planung und Reflexion empirischer Untersuchungen, Forschungsdesigns und -methoden sind deshalb zentrale Gegenstände des Studiengangs im Basisbereich. Neben forschungsbasierten Modulen werden ebenso für soziale Masterstudiengänge zentrale Thematiken wie zielgruppengerechte Kommunikation sowie Ethik und Management in rehabilitationswissenschaftlichen Kontexten behandelt. - Der Studiengang ist zukunftsorientiert.
Eine inklusive Gesellschaft ist eines unserer großen Zukunftsthemen. Der Studiengang Rehabilitationswissenschaften reagiert im Profilbereich auf diese aktuelle gesellschaftliche Aufgabe mit zukunftsorientierten inhaltlichen Schwerpunkten. - Der Studiengang ist anwendungsbezogen.
Der Wert wissenschaftlicher Erkenntnisse liegt im Transfer auf die Praxis. Deshalb ist ein konsequenter Anwendungsbezug durchgängiges Merkmal des Studiengangs in allen seinen Elementen: Forschungspraxis im Basisbereich, Projektmodul im Profilbereich und Masterthesis, mit der eigenständig eine anwendungsbezogene wissenschaftliche Fragestellung bearbeitet wird.
Der Master-Studiengang Rehabilitationswissenschaften
- vermittelt Fähigkeiten, um Konzepte und Prozesse zur Diagnostik und Förderung sowie Nutzung technologischer Assistenzen nachhaltig zu planen, evidenzbasiert zu implementieren und zu evaluieren sowie forschungsbasiert weiterzuentwickeln,
- bereitet auf die Übernahme von Leitungsverantwortung, Konzeptentwicklung, Prozess- und Forschungssteuerung sowie Ergebnisanalyse vor,
- sensibilisiert für einen flexiblen Umgang mit gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen im Rehabilitationskontext und trägt nachhaltig zum innovativen Wandel moderner Demokratischer Gesellschaften bei.
Der Studiengang bietet
- Learning-Teaching-Agreements zwischen Lehrenden und Studierenden;
- ein Mentoring-Programm zwischen Studierenden und Mentor_innen mit Leitungsfunktion in Einrichtungen des Rehabilitationssystems;
- ein projektorientiertes Studium;
- kleine Lern- und Arbeitsgruppen;
- die Nutzung von Praxis- und Forschungseinrichtungen der Fakultät.
Studienaufbau
Das Studium legt zu Beginn den Fokus auf spezifische Themen der Rehabilitationswissenschaften. Ab dem zweiten Semester steht das Profilstudium im Mittelpunkt, das vierte Semester dient der Anfertigung der Masterarbeit.
120 Leistungspunkte verteilen sich wie folgt:
- Basisbereich: 40 Leistungspunkte (LP)
- Profilbereich: 50 LP (32 LP plus 18 LP in drei einführenden Modulen)
- Masterarbeit: 30 LP
Basisbereich
Folgende fünf Basismodule sind verpflichtend für alle Studierenden:
- Profession, Ethik und Management in rehabilitationswissenschaftlichen Handlungsfeldern
- Inklusion und Teilhabe in rehabilitationswissenschaftlicher Forschung und Praxis
- Forschungsdesigns und Forschungspraxis
- Datenauswertung und Ergebnisinterpretation
- Zielgruppengerechte Kommunikation
Die Basismodule sollen den Studierenden eine Vertiefung in fachspezifisches Denken geben, um komplexe rehabilitationswissenschaftliche Fragestellungen, pädagogische Prozesse sowie organisatorische und institutionelle Rahmenbedingungen konzipieren und gestalten zu können. Sie orientieren sich an Themen, die für pädagogische bzw. soziale Masterstudiengänge erforderlich sind und die auf Funktionen und Tätigkeiten im weiteren (Wissenschafts-)Management vorbereiten. Darüber hinaus werden Kenntnisse von empirischen Forschungsmethoden (qualitativ und quantitativ) erweitert und vertieft.
Der Forschungsorientierung des Masterstudiengangs entsprechend erwerben die Studierenden Fähigkeiten in der Planung, Durchführung und Evaluation von Forschungsprojekten unterschiedlicher Dimension und Zielsetzung. In der Forschungspraxis können sie Erfahrungen in der Rolle der Forscher_innen sammeln und unter ethischen und professionstheoretischen Gesichtspunkten reflektieren.
Profilbereich
Der Profilbereich startet für alle Studierenden im ersten Semester, wobei zunächst alle Einführungsmodule der drei Profile studiert werden müssen. Somit ist gewährleistet, dass die Studierenden einen Überblick über aktuelle und mögliche Themen der einzelnen Profile gewinnen. Ab dem zweiten Semester wird eines der folgenden drei Profile vertieft studiert:
- Im Profil Digitalisierung und Technologien zur Teilhabe ist die Entwicklung und Evaluation Assistiver Technologien und neuer Medien zentrales Anliegen, um Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
- Im Profil Entwicklung und Bildung über die Lebensspanne steht die Optimierung von Lern- und Entwicklungsbedingungen für Menschen mit Behinderungen im Fokus, um deren Partizipation an Sozialisations- und Bildungsprozessen zu erweitern.
- Im Profil Teilhabe und Inklusion in Arbeit und Gesundheit werden die Entwicklung und Erforschung von Chancen und Risiken für Ansätze und Programme zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Arbeit und Gesundheit forciert.
Zulassungsvoraussetzungen
- Ein abgeschlossenes Bachelor-Studium in Rehabilitationspädagogik, Sonder- oder Heilpädagogik oder ein Abschluss in affinen Studiengängen.
- Die Anerkennung vergleichbarer Studienabschlüsse erfolgt durch den Prüfungsausschuss.
- Bachelor-Abschlussnote: mind. gut (2,3)
- Einschreibung: Studienbeginn nur zum Wintersemester möglich
Beratung und Information
Studienfachberatung an der Fakultät
Die Studienfachberatung informiert über Inhalte und Formalia des Studiums. Sie berät und unterstützt Studierende in Fragen der Planung, Organisation und Durchführung des Studiums.
Tel.: 0231-755-5898
E-Mail: studienfachberatung.reha@tu-dortmund.de
Fachschaft Rehabilitationswissenschaften
Die Fachschaft Rehabilitationswissenschaften ist Ansprechpartner für die Belange der Studierenden.
Tel.: 0231-755-5458
E-Mail: fachschaft.fk13@tu-dortmund.de
Studierendensekretariat der TU
Rechtsverbindliche Auskünfte zur Zulassung und zur Einschreibung gibt das Studierendensekretariat der TU Dortmund:
Emil-Figge-Str. 61, 44227 Dortmund
www.tu-dortmund.de/studierendensekretariat
Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium (DoBuS)
DoBuS ist zuständig für chancengleiche Studienbedingungen und berät Studierende mit Behinderung und chronischer Krankheit:
Tel: 0231-755-2848
www.dobus.tu-dortmund.de
Weitere Infos zum Studiengang finden Sie auf der Website der Universität
Zur Website >
Master of Arts (ID 27017)
1. Semester
- Digitalisierung und Technologien zur Teilhabe: Einführung (6 CP)
- Digitalisierung und Technologie – Theorien, Entwicklungen und Auswirkungen auf Gesellschaft, Organisation und Individuum (3 CP)
- Vertiefung und Übung im Rahmen eines Blended Learning Seminars (3 CP)
- Entwicklung und Bildung über die Lebensspanne: Einführung (6 CP)
- Methoden und Modelle der Diagnostik, Prävention, Intervention (3 CP)
- Übung zur Vorlesung (3 CP)
- Forschungsmethoden 1: Forschungsdesigns und Forschungspraxis (8 CP)
- Forschungspraxis (5 CP)
- Versuchsplanung und Datenerhebung (3 CP)
- Inklusion und soziale Teilhabe in rehabilitationswissenschaftlicher Forschung und Praxis (8 CP)
- Analyse und Evaluation von Inklusion und sozialer Teilhabe im Kontext wissenschaftstheoretischer Perspektiven (5 CP)
- Relevante Diskurse und Theorien in Bezug zu den Rehabilitationswissenschaften (5 CP)
- Profession, Ethik und Management in rehabilitationspädagogischen Arbeitsfeldern (8 CP)
- Management und Organisation (5 CP)
- Professionstheoretische und ethische Debatten und Entwicklungen (3 CP)
- Teilhabe und Inklusion in Arbeit und Gesundheit: Einführung (6 CP)
- Teilhabe und Inklusion in Arbeit und Gesundheit: Konzepte, Theorien, Programme im Überblick (3 CP)
- Vertiefung der Themen zur Teilhabe (3 CP)
2. Semester
- Digitalisierung und Technologien zur Teilhabe: Analyse (11 CP)
- Digitalisierung und Mediatisierung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive (3 CP)
- Technikimplementierung in sozialen Einrichtungen (4 CP)
- Technologien und technische Systeme kennen und verstehen lernen (4 CP)
- Entwicklung und Bildung über die Lebensspanne: Diagnostik (10 CP)
- Diagnostik im Bereich Bildung (5 CP)
- Diagnostik im Bereich Entwicklung und Verhalten (5 CP)
- Forschungsmethoden 1: Forschungsdesigns und Forschungspraxis (8 CP)
- Forschungspraxis (5 CP)
- Versuchsplanung und Datenerhebung (3 CP)
- Forschungsmethoden 2: Datenauswertung und Ergebnisinterpretation (8 CP)
- Qualitative Methoden für Fortgeschrittene (3 CP)
- Quantitative Methoden für Fortgeschrittene (3 CP)
- Übung zu Forschungsmethoden (2 CP)
- Inklusion und soziale Teilhabe in rehabilitationswissenschaftlicher Forschung und Praxis (8 CP)
- Analyse und Evaluation von Inklusion und sozialer Teilhabe im Kontext wissenschaftstheoretischer Perspektiven (5 CP)
- Relevante Diskurse und Theorien in Bezug zu den Rehabilitationswissenschaften (5 CP)
- Teilhabe und Inklusion in Arbeit und Gesundheit: Analyseperspektiven (12 CP)
- Analyseperspektiven zur Teilhabe und Inklusion in Arbeit (3 CP)
- Analyseperspektiven zur Teilhabe und Inklusion in Gesundheit (3 CP)
- Vertiefung von Analyseperspektiven zur Teilhabe und Inklusion (6 CP)
- Zielgruppengerechte Kommunikation (8 CP)
- Digitale Kommunikation in professionellen Settings (3 CP)
- Professionelle Gesprächsführung (2 CP)
- Theorie und Praxis interpersoneller Kommunikation und Beratungen (3 CP)
3. Semester
- Digitalisierung und Technologien zur Teilhabe: Anpassung & Ausgestaltung (11 CP)
- Evaluation des Einsatzes von technischen Systemen unter Berücksichtigung technischer, sozialer, rechtlicher und ethischer Aspekt (3 CP)
- Interdisziplinäre Perspektiven der Technikentwicklung und Technikanwendung (3 CP)
- Planung, Implementierung und Evaluation eines technischen Systems (5 CP)
- Entwicklung und Bildung über die Lebensspanne: Prävention und Intervention (12 CP)
- Evaluation von Präventions- und Interventionsmaßnahmen (4 CP)
- Prävention und Intervention bei Entwicklungs- und Verhaltenssauffälligkeiten (4 CP)
- Prävention und Intervention im Bildungskontext (4 CP)
- Forschungsmethoden 2: Datenauswertung und Ergebnisinterpretation (8 CP)
- Qualitative Methoden für Fortgeschrittene (3 CP)
- Quantitative Methoden für Fortgeschrittene (3 CP)
- Übung zu Forschungsmethoden (2 CP)
- Projekt TAG (10 CP)
- Eigenstudium (8 CP)
- Forschungsprojekt: Fragestellung, Methodik, Design, Durchführung, Auswertung der Daten und Diskussion der Ergebnisse. (2 CP)
- Teilhabe und Inklusion in Arbeit und Gesundheit: Anpassung und Ausgestaltungsprozesse (10 CP)
- Teilhabe und Inklusion in Arbeit: Planung, Anpassung und Evaluation (4 CP)
- Teilhabe und Inklusion in Gesundheit: Planung, Anpassung und Evaluation (6 CP)
- Zielgruppengerechte Kommunikation (8 CP)
- Digitale Kommunikation in professionellen Settings (3 CP)
- Professionelle Gesprächsführung (2 CP)
- Theorie und Praxis interpersoneller Kommunikation und Beratungen (3 CP)
4. Semester
- Masterarbeit (30 CP)